
"Erkenntnis ist mir
wichtiger als Macht."

Porträt von Harald zur Hausen gezeichnet von Cedric Gregor und ausgestellt im Rahmen der DKFZ-internen Gedenkfeier.
© J. Jung / DKFZ
Harald zur Hausen, der Medizin-Nobelpreisträger und langjährige Vorstandsvorsitzende des DKFZ, hat mit seiner Forschung die Grundlagen für die Entwicklung einer Schutzimpfung gegen krebserregende humane Papillomviren geschaffen. Von dieser wissenschaftlichen Leistung profitieren mittlerweile Millionen Menschen auf der ganzen Welt. „Ohne Übertreibung kann man sagen, dass Harald zur Hausen damit eine ganz neue Dimension der Krebsprävention eröffnet hat", würdigt Michael Baumann, Vorstandvorsitzender und Wissenschaftlicher Vorstand des DKFZ. Am 29. Mai 2023 starb er im Alter von 87 Jahren. Ein Bild von ihm als Menschen und Wissenschaftler zeichnet ein Portrait, das 2008 in der Nobelbroschüre erschien:
Dass man eines Tages den Krebs besiegen könne, sagt Harald zur Hausen, würde er hoffen, aber nie zu behaupten wagen. Wohl aber, dass man ihn besser verstehen lernt. Und er ist überzeugt, dass sich aus diesem Verständnis immer mehr Chancen ergeben werden, Krebs seinen Schrecken zu nehmen – oder zu verhindern, dass er entsteht. Die Krebsentstehung verhindern, Krebs vorbeugen – die Arbeit von Harald zur Hausen ist ein Paradebeispiel dafür, dass dies möglich ist: Seiner grundlegenden Forschung verdankt die Welt die erste Impfung, die gezielt gegen eine Krebsart, Gebärmutterhalskrebs, entwickelt wurde. Mit „großer Beharrlichkeit", lobte ein Mitglied des Nobelpreiskomitees, habe Harald zur Hausen seine Forschungsarbeiten über die Jahrzehnte und Widerstände hinweg vorangetrieben. „Das mit der Beharrlichkeit", meint Harald zur Hausen, „ist schon wahr. Ich bin ein westfälischer Dickkopf."
Geboren ist Harald zur Hausen am 11. März 1936 in Gelsenkirchen. Mit sechs Jahren kam er in die Schule, doch die endete bereits, kaum dass sie begonnen hatte: Es war Krieg, die Schule wurde geschlossen. „Uns Kinder", sagt Harald zur Hausen, „hat das nicht sonderlich gestört." Im Jahr 1945 öffneten die ersten Schulen wieder, und seine Tante, eine Lehrerin, sorgte dafür, dass ihr Neffe direkt in die vierte Klasse einsteigen konnte. „Ich hatte nicht die geringste Basis dafür", erinnert sich zur Hausen. Die Aufnahmeprüfung für die Höhere Schule hat er dennoch geschafft, das müsse im Frühsommer 1946 gewesen sein: „Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich das hinbekommen habe – wahrscheinlich mit Ach und Krach."
Bilder aus dem Leben Harald zur Hausens
Quellen: DKFZ, DKFZ/Josef Wiegand, DKFZ/Brigitte Engelhardt, DKFZ/Nicole Schuster, DKFZ/Tobias Schwerdt, privat, The Nobel Foundation 2008. Musik: pixabay

1957
© privat
Die erste Klasse im Gymnasium sei „einfach grauenhaft" gewesen, und am Ende stand auf dem Zeugnis „Versetzung nur mit großem Bedenken". Er habe sich dann den „notwendigen Hintergrund" erarbeitet. Danach, meint Harald zur Hausen, sei alles recht gut gelaufen: „Ich würde mal sagen, so im durchschnittlichen Bereich." Überdurchschnittlich, meint er, sei da schon eher seine Naturbegeisterung gewesen. Schon als kleines Kind habe er sich sehr für Tiere, besonders für Vögel, interessiert, aber auch für Pflanzen – und sogar für Gartenarbeit. Mit einem Freund, der von einem Bauernhof stammte, ist er oft in benachbarte Wälder und Heiden aufgebrochen, um dort „alles Mögliche zusammenzutragen oder Eidechsen zu fangen – was Jungs halt so machen." Auch später, als er mit seiner Familie vom Ruhrgebiet nach Vechta in Südoldenburg gezogen war, spazierte er gerne in die umliegenden Moore, um die Natur zu beobachten, meist allein. Seine ungewöhnlich frühe und intensive Neigung, sich mit der Natur und dem Leben zu beschäftigen, sei insgesamt „wohl schon ein bisschen außer der Reihe" gewesen, schätzt Harald zur Hausen heute.
Das frühe Interesse an Tieren und Pflanzen sei möglicherweise ein väterliches Erbe. Der Vater stammte von einem Bauernhof in der Nähe von Gladbeck und studierte Landwirtschaft, bis er sein Studium während des Ersten Weltkrieges abbrechen musste. Mit der Baltischen Landeswehr kam sein Vater 1919 nach Lettland. „Dort lernte er meine Mutter, eine Lettin, kennen", erzählt Harald zur Hausen: „Die beiden haben nach vier Wochen geheiratet – das hat erstaunlicherweise ein Leben lang gehalten." Seine Mutter habe, wie so viele Menschen damals, kein leichtes Leben gehabt. Ihr Vater war an Tuberkulose verstorben, als sie ein junges Mädchen war; wenig später verlor sie auch ihre Mutter, „an Gebärmutterhalskrebs übrigens", bemerkt Harald zur Hausen.
Er erinnert sich, dass seine Mutter immer davon gesprochen habe, dass sie gerne Ärztin geworden wäre. „Aber in den schweren Kriegs- und Nachkriegszeiten hatte sie keine Chance, sich diesen Wunsch zu erfüllen." Vielleicht sei sein medizinisches Interesse ja von ihr bestimmt. Am glücklichsten habe er seine Mutter immer erlebt, wenn sie alle ihre Kinder beisammen hatte. Das waren drei Söhne und eine Tochter, Harald war ihr jüngstes Kind. „Wir waren finanziell in keiner günstigen Situation", sagt zur Hausen. „Aber wir haben alle eine sehr gute Ausbildung erhalten."
Während der Gymnasialzeit schälten sich rasch seine ausgeprägten naturwissenschaftlichen Neigungen heraus. Biologie war sein Lieblingsfach, da habe er einen „gewissen Ehrgeiz" entwickelt. Auch den Chemieunterricht hat er gemocht. Und geschrieben habe er immer gerne, vor allem die Aufsätze über Literatur und Philosophie im Deutschunterricht der Oberstufe. In seiner Freizeit las er vorzugsweise Biografien von Forscherpersönlichkeiten. Besonders die Lebensgeschichte von Robert Koch hat ihn beeindruckt. Am wenigstens konnte er sich mit dem Religionsunterricht und noch weniger mit den Religionslehrern anfreunden. Da habe ich mir die heftigsten Diskussionen erlaubt", erinnert sich zur Hausen. Schon als Schüler stand ihm die „zentrale und brennende Frage" vor Augen, dass es doch möglich sein müsse, eine mechanistische Erklärung für Lebensvorgänge zu finden. Der Widerspruch zwischen dem, was er im Religionsunterricht hörte, und dem, was er in den Naturwissenschaften erfuhr, habe ihn herausgefordert und sein Denken bestimmt. So ganz losgelassen hat ihn das Nachsinnen darüber bis heute nicht: „Genom und Glaube" lautet der Titel seines Buches, das er zwei Jahre vor seiner Verabschiedung als Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand des Deutschen Krebsforschungszentrums schrieb. Darin fordert er auf, den Glauben „wo immer möglich durch Wissen" und „geistige Statik" durch die Dynamik zu ersetzen, welche die Evolution vorgibt. „Natürlich wissen wir nicht, ob uns eine solche Rationalität die Zukunft sichert", schreibt er als Schlusssatz, „aber haben wir Alternativen?"
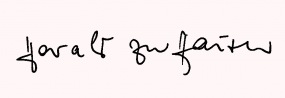
© dkfz.de
Nach dem Abitur im Jahr 1955 entschied sich zur Hausen zu einer Art Doppelschlag: Er studierte gleichzeitig Biologie und Medizin. Erstaunliche sieben Semester lang hielt er durch. Dann musste er einsehen, dass sein Vorhaben nicht länger zu halten war. „Vor dem Physikum", blickt er zurück, „hätte sich die Entscheidung fast als katastrophal erwiesen, weil mir zu wenig Zeit geblieben war, medizinische Vorlesungen zu hören." Er habe damals gearbeitet „wie nie zuvor und nie mehr danach", um aufzuholen, was ihm in der Medizin fehlte. Der Entschluss, das Biologiestudium aufzugeben, ergänzt er, sei aber auch davon beeinflusst gewesen, dass der Unterricht an den Universitäten „damals einfach schlecht" war. Molekularbiologie sei praktisch überhaupt nicht gelehrt worden, obwohl dieses Fach sich damals schon zu etablieren begann. Stattdessen habe er die Mundwerkzeuge von Insekten zeichnen müssen. Nein, es liege ihm fern, sich darüber lustig zu machen, auch das habe seine Berechtigung. Aber auf diese Art und Weise seien doch viele Entwicklungen an einem vorbeigegangen, die man sich als junger Wissenschaftler nach dem Studium mühevoll habe aneignen müssen.
Das Medizinstudium verlief nach dem dann doch sehr gut bestandenen Physikum erfolgreich. Eine erste Doktorarbeit im Tropeninstitut in Hamburg beendete er allerdings schon nach kurzer Zeit: „Ich sollte Amöbenzysten im Stuhl von Affen zählen", erinnert sich zur Hausen. Als er sich ausrechnete, dass diese Fleißarbeit mindestens drei Jahre beanspruchen würde, verlor er die Lust am Amöbenzystenzählen. Er wechselte an das Institut für Mikrobiologie in Düsseldorf und wandte sich dort einem Thema zu, das auf den ersten Blick weder einen biologischen noch einen medizinischen Hintergrund hatte: Er beschäftigte sich mit Bohnerwachsen. Zunächst, gesteht er ein, habe er auch diese Arbeit als extrem unattraktiv empfunden, er sei dennoch dabei geblieben, und schließlich habe sich die Aufgabe interessant entwickelt. Er stellte nämlich fest, dass bestimmte Bohnerwachse, wenn sie in Tuberkuloseheilstätten ultraviolettem Licht ausgesetzt sind, Tuberkelbakterien abtöten. „Also, ich schäme mich in keiner Weise für diese Doktorarbeit", sagt Harald zur Hausen.
Nach Studium und Promotion arbeitete er von 1960 bis 1962 als Medizinalassistent in den Krankenhäusern von Wimbern im Sauerland, Isny im Allgäu, Gelsenkirchen und Düsseldorf. „Ich wollte die Approbation als Arzt", sagt Harald zur Hausen, „dafür musste ich die klinische Zeit absolvieren." Es seien zwei gute Jahre gewesen. Vor allem der intensive Kontakt zu den Patienten habe seine Haltung auch später, als er in der Forschung angekommen war, beeinflusst. „In meinem Herzen wollte ich stets immer nur wissenschaftlich arbeiten", betont Harald zur Hausen. Als er schließlich im Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Düsseldorf seine Forscherlaufbahn beginnen konnte, war er zutiefst enttäuscht: „Das waren die ödesten Wochen meines Lebens – ich bekam keine vernünftige Anleitung, stand hilflos im Labor herum und konnte mich nur fragen: So what?"
Seine vielzitierte Beharrlichkeit stieß hier an eine Grenze: „Ich war damals entschlossen, wieder in die Klinik zurückzugehen", sagt Harald zur Hausen. Eine „Kette merkwürdiger Ereignisse" habe das allerdings verhindert. Nach einigen vergeblichen Anläufen, eine attraktive Stelle zu finden, seien die Arbeiten im Düsseldorfer Labor besser gelaufen, „und ich fand zu meiner Freude an der Forschung zurück".

1967 in Philadelphia
© privat
Von entscheidender Bedeutung waren die Jahre von 1966 bis 1969. Zur Hausen verbrachte sie bei dem deutschstämmigen Forscherehepaar Gertrude und Werner Henle im Children's Hospital of Philadelphia, USA. Seinen ungewöhnlichen Anfang nahm der Aufenthalt des jungen Forschers in Übersee mit einem Griff in den Papierkorb: Die Henles hatten auf der Suche nach einem Forschungsassistenten eine Anfrage nach Düsseldorf geschickt, doch der Brief landete im Papierkorb, weil niemand Interesse daran zeigte. „Als ich zufällig davon erfuhr", erzählt Harald zur Hausen schmunzelnd, „habe ich das Schreiben wieder aus dem Papierkorb gefischt und mich beworben." Diesem Zufallsfund, betont er, verdanke er sein wissenschaftliches Handwerkszeug – und die erste unmittelbare Beschäftigung mit einem Thema, das ihn in seinem weiteren Forscherleben nicht mehr loslassen sollte: Gertrude und Werner Henle hatten Anfang der 60er Jahre erstmals zeigen können, dass zwischen einem Virus, dem Epstein-Barr-Virus, und einer Krebserkrankung, dem in Afrika häufig vorkommenden Burkitt- Lymphom, ein Zusammenhang besteht. „Viren und Krebs" – das blieb auch das Forschungsthema von Harald zur Hausen.
Es war ein Außenseiterthema – aber ein vielversprechendes: Das Feld war noch weitgehend unbestellt, und Harald zur Hausen begann unverzüglich, es zu beackern. Von Amerika ging er zunächst an die Universität Würzburg, wo er ab 1969 im Institut für Virologie die Gelegenheit bekam, seine eigene Forschungsgruppe aufzubauen. 1972 wechselte er an das Institut für Klinische Virologie der Universität Erlangen-Nürnberg. „Das waren glückliche Zeiten", erinnert sich Harald zur Hausen rückblickend.

© dkfz.de
Im Jahr 1977 erhielt er einen Ruf auf den Lehrstuhl für Virologie der Universität Freiburg – und nahm ihn nach langer Überlegung an: „Das dortige Institut für Virologie war gut etabliert, hatte aber aufgrund öffentlicher Diskussionen über die Nebeneinnahmen von Professoren einen relativ schlechten Ruf", sagt zur Hausen. „Ich hielt es für eine Herausforderung, hier tätig zu werden." Seine Erlangener Arbeitsgruppe folgte ihm fast geschlossen. Im Freiburger Institut für Virologie wurden im Wesentlichen die Erkenntnisse erarbeitet, die zur Grundlage für die Entwicklung des Impfstoffes gegen Gebärmutterhalskrebs wurden. Otmar D. Wiestler, der derzeitige Wissenschaftliche Stiftungsvorstand des Deutschen Krebsforschungszentrums, lernte Harald zur Hausen in dieser Freiburger Zeit als junger Assistenzarzt in einem gemeinsamen Sonderforschungsbereich kennen. „Er war damals schon eine Persönlichkeit, die wir außerordentlich schätzten", erinnert sich Wiestler, „und auch ein wenig bewunderten."
Die nächste Herausforderung wurde im Jahr 1983 an Harald zur Hausen herangetragen: Das in die Krise geratene Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg brauchte einen neuen Chef. Harald zur Hausen erzählt, dass er aufgrund der permanenten Schwierigkeiten, die er mit der Verwaltung der Freiburger Universität und dem damaligen Kanzler hatte, nicht uninteressiert an einem Wechsel gewesen sei. „Ich habe ein Konzept erarbeitet und bekam die Gelegenheit, es dem Wissenschaftlichen Rat des Krebsforschungszentrums vorzustellen", erklärt zur Hausen. „Dann wurde eine Reihe kritischer Fragen gestellt, unter anderem, wie ich überhaupt auf die Idee kommen könne, eine so große Einrichtung wie das DKFZ zu führen."
Er leitete das Zentrum – wie ihm mittlerweile alle bescheinigen – sehr schnell sehr gut: insgesamt zwanzig Jahre lang, von 1983 bis 2003. In dieser Zeit stieg das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg zu einem der führenden Krebsforschungszentren der Welt auf. Selbst ehemalige Kritiker lobten zur Hausen als Wissenschaftler und als Wissenschaftsmanager. Nur Harald zur Hausen selbst zweifelte insgeheim: „Ich verhehle es nicht – mich hat es die ganzen 20 Jahre verfolgt, ob die Entscheidung, von Freiburg nach Heidelberg zu gehen, richtig gewesen ist." Bei allen Problemen, mit denen er in Freiburg zu kämpfen hatte, sei ihm doch insgesamt mehr Zeit für intensives wissenschaftliches Arbeiten geblieben. In Heidelberg habe er vieles, was er eigentlich gerne selbst angegangen wäre, delegieren müssen. „Für einen Vorstandsvorsitzenden habe ich dennoch die wissenschaftliche Arbeit, glaube ich, in einem ungewöhnlichen Ausmaß betrieben", sagt zur Hausen. „Ich stelle mir trotzdem auch heute noch die Frage, ob ich nicht so manch eine Chance vergeben habe."
„Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, Macht auszuüben", sagt Harald zur Hausen, „das hat mich nie berührt." Berührt ist er vielmehr davon, dass er mit der Leitung eines so großen Zentrums die Chance erhalten hat, Forschungsrichtungen zu beeinflussen und Kurswechsel zu bewirken. „Ich denke sagen zu können, dass ich diese Einflussnahme hier im Hause intensiv betrieben habe. Das hat mich sehr befriedigt. Und wenn ich dann auch noch sehen durfte, dass die Dinge tatsächlich gut liefen, war es umso schöner für mich."
Und was ist dem Menschen Harald zur Hausen, fernab von der Wissenschaft, wichtig? „Das ist kaum zu trennen", antwortet er nachdenklich und stellt seine große blaue Kaffeetasse mit dem Schriftzug HzH auf den kleinen Tisch. „Mir persönlich", sagt er dann, „war es immer besonders wichtig, stets mit einer gewissen Gelassenheit und Freundlichkeit an die Menschen und an die Dinge heranzugehen. Ich hoffe, das ist mir überwiegend gelungen."
