Cancer Survivorship
- Krebsrisikofaktoren und Prävention

Prof. Dr. Volker Arndt
Leitung
Die AG Cancer Survivorship wurde im März 2016 eingerichtet und ist mit der Abteilung Klinische Epidemiologie und Alternsforschung assoziiert. Der international gebräuchliche Begriff "Cancer Survivorship" bezieht sich auf das Leben mit und nach einer Krebserkrankung.

Erfreulicherweise haben sich während der letzten Jahrzehnte die Überlebensraten bei den meisten Krebserkrankungen deutlich verbessert. Schätzungsweise gibt es derzeit in Deutschland etwa fünf Millionen "Cancer Survivors" (im Deutschen besser "Krebsbetroffene"), d.h. Personen, die irgendwann einmal die Diagnose Krebs bekommen haben. Über 60% davon sind Langzeitüberlebende, das heißt Personen, die fünf und mehr Jahre nach der Diagnose von Krebs überlebt haben. Für viele Betroffene stellt Krebs eine chronische Erkrankung dar, die sich auch Jahre nach der Diagnose noch auf die Gesundheit und die Lebensqualität auswirken kann.
Unsere Forschung

Unsere Forschung konzentriert sich auf kurz- und langfristige physische, psychologische, soziale und ökonomische Folgen von Krebs und seiner Behandlung bei von Krebs Betroffenen und deren Familien. Auch untersuchen wir, bei welchen Gruppen von Krebsbetroffenen (z.B. nach Geschlecht, Krebsart oder sozialem Hintergrund) entsprechende Folgen gehäuft auftreten. Zudem sind wir in internationalen Projekten aktiv beteiligt, in denen Instrumente zur Erfassung der Lebensqualität von Krebsbetroffenen entwickelt werden. Mit den Ergebnissen unserer Forschung zielen wir darauf ab, Ansatzpunkte für eine verbesserte risikoadaptierte Versorgung und Nachsorge zu identifizieren.
Projekte
Der Ursprung unserer Arbeit ist begründet in großen populationsbasierten Kohortenstudien zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität, Langzeit- und Spätfolgen von Krebs (CAESAR, PROCAS, DACHS/ IMPACT). Hinzu kamen weitere Studien zu bestimmten Themen wie z.B. den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Krebsbetroffene (CroKuS) oder unerfüllten Bedarfen (EiBe), sowie registerbasierten Studien (CapGer, CoDiCa). Darüber hinaus beteiligen wir uns an internationalen Projekten und Initiativen wie EORTC QLQ-SURV, EUonQoL und INE-CSC. Nachdem zahlreiche Studien die Bedarfe von Krebsbetroffenen aufgezeigt haben, arbeiten wir mit IMPULS-A auch an einem Interventionsprojekt, in dem ein Survivorship-Programm entwickelt und in einer randomisierten kontrollierten Studie evaluiert wird.
IMPULS-A – Implementierung eines Unterstützungsprogramms für Langzeitkrebsüberlebende im Alter (in Kooperation mit dem NCT Heidelberg)
Von den ca. 5. Mio von Krebs Betroffenen in Deutschland sind ca. 2/3 über 65 Jahre alt. Die Gruppe der älteren Personen mit/nach einer Krebserkrankung ist einerseits durch verminderte körperliche Reserven und andererseits durch komplexe Überschneidungen zwischen den Langzeit- und Spätfolgen der Krebserkrankung sowie sonstigen Gesundheitsproblemen charakterisiert. Entsprechend wichtig sind spezifische Versorgungsangebote für Ältere im Anschluss an die Akutbehandlung, die umfassend und interdisziplinär die verschiedenen Problembereiche altersgerecht adressieren und die Wahrscheinlichkeit der Entstehung weiterer Langzeit- und Spätfolgen reduzieren. Das Projekt IMPULS-A zielt darauf ab, ein Survivorship-Programm für ältere Patienten zu entwickeln, zu implementieren und zu evaluieren, welches auf einer besseren Vernetzung regionaler Versorgungsangebote für von Krebs Betroffene aufbaut. Die Wirksamkeit dieses regionalen Netzwerkprojekts gegenüber der bisher üblichen Nachsorge soll in einem randomisiert-kontrollierten Design überprüft werden.
Teilnehmende der Interventionsgruppe erhalten ein regelmäßiges Assessment ihres Unterstützungsbedarfs. Sollten Bedarfe identifiziert werden, unterbreitet ein Care-Navigator entsprechende Beratungs-/ Behandlungsangebote und stimmt sie mit dem persönlichen Patientenwunsch ab. Zudem werden für typische altersspezifische Bedarfe nach einer Krebserkrankung Empfehlungen ausgesprochen und detaillierte Informationsmaterialien (digital und analog) in verständlicher Sprache ausgegeben.
Neben Effekten auf die Gesundheitskompetenz sollen Wirkungen auf Lebensqualität, Inanspruchnahme, persönliche Ressourcen und Behandlungszufriedenheit sowie Umsetzbarkeit geprüft werden.
INE-CSC – Implementation Network Europe „Cancer Survivorship Care“ / Europäisches Implementierungsnetzwerk „Cancer Survivorship Care“ (PI Prof. Josephine Hegarty, University College Cork, Irland)
Hauptziel dieser europäischen Kooperation ist die Umsetzung evidenzbasierter Interventionen in die klinische Routine als Teil einer sektorenübergreifenden, ganzheitlichen Krebsnachsorge und letztlich die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens nach einer Krebserkrankung.
CoDiCa – Causes of Death in Cancer Patients / Todesursachen bei Krebs (in Kooperation mit dem Epidemiologischem Krebsregister Baden-Württemberg, dem Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) und dem Deutschen Krebsregister e.V.)
Während sich erfreulicherweise die Überlebensraten nach einer Krebserkrankung in den letzten Jahren verbessert haben, konkurrieren zunehmend nicht krebsbedingte Ereignisse, einschließlich möglicher Langzeit- und Spätfolgen, inzwischen mit Krebs als Todesursache. Allerdings haben sich nur wenige Studien auf die ursachenspezifische Sterblichkeit in der Gesamtpopulation von Krebsbetroffenen konzentriert. Die Mortalitätsmuster und das Risiko der nicht krebsbedingten Sterblichkeit bei Krebsbetroffenen sind nach wie vor unbekannt. Ziel dieser Studie ist es daher, die Todesursachen bei Krebsbetroffenen in Deutschland zu analysieren, differenziert nach Krebsart (und -stadium), Kalenderjahr, Geschlecht und Patientenalter, Zeit nach der Diagnose sowie Histologie und Behandlungsart.
Die Ergebnisse der Pilotstudie anhand der Daten des Krebsregisters Baden-Württemberg zeigten bei Personen nach einer Krebsdiagnose gegenüber der Allgemeinbevölkerung ein erhöhtes Sterberisiko aufgrund von Infektionen, Lebererkrankungen und Suiziden. Die Ergebnisse der bundesweiten Studie sollen wichtige Einblicke in sich verändernde Sterblichkeitstrends liefern und dazu beitragen, die Nachsorge auch bezüglich möglicher Langzeit- und Spätfolgen und damit das Outcome für die Betroffenen zu verbessern.
LUChS - Longitudinal Quality of Life of Cancer Survivors / Langfristige Lebensqualität von Krebsbetroffenen (in Kooperation mit dem Klinikum Stuttgart und dem Onkologischen Schwerpunkt Stuttgart (OSP))
Dieses Projekt zielt darauf ab, Krebsbetroffene zu identifizieren, die anfällig für Langzeit-/Spätfolgen der Erkrankung und Behandlung sein könnten. Hierzu wird der Langzeitverlauf der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (LQ) und der Symptombelastung erhoben. Seit 2003 erhebt der OSP die LQ von Krebsbetroffenen, die in einer der OSP-Kliniken behandelt wurden. Die Teilnehmer füllen einen LQ -Fragebogen zum Zeitpunkt der Rekrutierung (während des stationären Aufenthalts oder kurz nach der Entlassung) und danach bis zu 10 Jahre lang jährlich aus. Diese LQ -Daten bieten zusammen mit detaillierten verfügbaren klinischen Daten eine einzigartige Gelegenheit, die Probleme und Bedürfnisse einer wachsenden Gruppe von Krebsbetroffenen im Laufe der Zeit zu untersuchen. Im Rahmen des LUCHS-Projekts konzentrieren wir uns auf Personen, die von Brust-, Prostata- oder Darmkrebs betroffen sind oder waren.

DACHS – Darmkrebs: Chancen der Verhütung durch Screening
IMPACT – Impact of clinical determinants, therapy, and lifestyle factors on long-term and late effects among colorectal cancer survivors / Einfluss von klinischen Faktoren, Therapie und Lebensstil auf Langzeit- und Spätfolgen bei Überlebenden mit Darmkrebs
(in Kooperation mit Klinische Epidemiologie und Alternsforschung und anderen)
Die DACHS-Studie ist eine epidemiologische Fall-Kontroll-Studie. Seit 2003 werden für diese Studie Darmkrebspatienten und zufällig ausgewählte Vergleichspersonen ohne Darmkrebs befragt, um sie anschließend miteinander zu vergleichen. Die Vergleichspersonen (Kontrollteilnehmer) entsprechen den Patienten in Alter und Geschlecht, und kommen aus den gleichen Städten und Landkreisen. Die Patienten werden bezüglich ihres Krankheitsverlaufs jahrelang regelmäßig nachbeobachtet. Die gegenwärtige Finanzierung (IMPACT3) erlaubt es, den Nachbeobachtungszeitraum auf 20 Jahre auszuweiten.
Zusätzlich zu den wiederholten patientenberichteten Endpunkten im Laufe der Nachbeobachtung wurden zu Studienbeginn auch Blutproben gesammelt. Diese können zusammen mit den tumorhistologischen Proben wertvolle Hinweise im Hinblick auf das Verständnis für molekularbiologische Aspekte bei der Entstehung von Langzeit- und Spätfolgen geben.
Anhand von Daten der DACHS haben wir gezeigt, dass eher Komorbiditäten als ein höheres Alter mit einer höheren Inanspruchnahme des Gesundheitswesens verbunden sind. Darüber hinaus fanden wir heraus, dass Lebensstilfaktoren wie ein geringeres Maß an körperlicher Aktivität mit mehr Fatigue einhergingen. Eine Änderung hin zu einem gesünderen Lebensstil seit der Krebsdiagnose (z. B. mehr körperliche Aktivität, gesündere Ernährung, mäßiger Alkoholkonsum oder Aufhören mit dem Rauchen) konnte jedoch die Lebensqualität verbessern und die Symptome bei der Nachuntersuchung verringern.
Eine weitere Untersuchung unserer Gruppe bei diesem Projekt hat gezeigt, dass minimalinvasive Operationstechniken, die bei Patientinnen und Patienten mit einer Darmkrebserkrankung im frühen Stadium (I-II) Darmkrebs mit der Intention eines schonenderen Eingriffes und verringerten postoperativer Komplikationen eingesetzt werden, gegenüber offener Operation keine Unterschiede bei der allgemeinen Lebensqualität aber dafür ein höheres Risiko für ein Darmkrebs-Rezidiv aufwiesen.
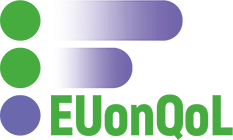
EUonQoL – Lebensqualität in der Onkologie: Erfassen, was für Menschen mit und nach Krebs in Europa wichtig ist (in Kooperation mit der EUonQoL Studiengruppe)
Das Projekt soll einen Beitrag zu den EU-Initiativen gegen Krebs leisten, indem es das European Oncology Quality of Life Toolkit (EUonQoL-Kit) entwickelt und validiert, ein Instrument zur Einschätzung der Lebensqualität von Personen mit oder nach einer Krebserkrankung in Europa. Das digital einzusetzende Toolkit wird gemeinsam mit Patientenvertretern und Interessenvertretern aus einer patientenzentrierten Perspektive entwickelt und auf den Gesundheitszustand von Personen während und nach einer der Patienten und Krebserkrankung zugeschnitten. Das endgültige EUonQoL-Kit soll in künftigen regelmäßigen Erhebungen zur Bewertung gesundheitspolitischer Maßnahmen eingesetzt werden.
Das EUonQoL-Kit wird derzeit in einer Piloterhebung bei einer breiten europäischen Stichprobe von Patienten in verschiedenen Phasen der Krebsbehandlung validiert. Unsere Arbeitsgruppe war in mehreren Arbeitspaketen aktiv an der Entwicklung und Validierung der deutschen Version des Toolkits beteiligt. Dazu gehörten die Literaturrecherche, die Überprüfung und Übersetzung des Toolkits und des Studienmaterials sowie die Rekrutierung und Datenerhebung.

EiBe – Evaluation individueller Bedürfnisse von Menschen mit und nach Krebs (in Kooperation mit dem Krebsinformationsdienst)
Der Krebsinformationsdienst (KID) am DKFZ berät kostenlos zu allen Fragen rund um das Thema Krebs. Die Studienidee entstand aus dem Interesse des KID, die unerfüllten Bedarfe („unmet needs“) der von Krebs betroffenen Anfragenden zu quantifizieren. Zu diesem Zweck wurde der Fragebogen „CASUN“ („Cancer Survivors' Unmet Needs“ – Unerfüllte Bedarfe von Krebsbetroffenen) ins Deutsche übersetzt und als Teil der regelmäßigen KID-Nutzerumfrage eingesetzt.
Die Ergebnisse zeigten, dass Nutzer des Krebsinformationsdiensts eine hohe Zahl von "unmet needs" (unerfüllten Bedarfen) berichten. Sie wünschen sich nicht nur Informationen über die Krebserkrankung selbst, sondern auch zur Verbesserung der Lebensqualität und zu ihrer gesundheitlichen Versorgung allgemein. Besonders Frauen, Teilnehmende mit geringerer Bildung, und Alleinlebende haben hohe unerfüllte Bedarfe. Zu den häufigsten unerfüllten Bedarfen gehören die Vernetzung und Koordination der Behandler untereinander, der Zugang zu komplementären/ alternativen Behandlungsmethoden, sowie Hilfe im Umgang mit Nebenwirkungen und Behandlungskomplikationen.
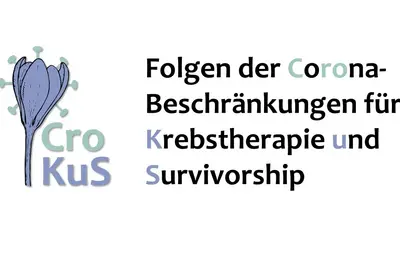
CroKuS - Folgen der Corona-Beschränkungen für Krebstherapie und Survivorship (in Kooperation mit Gesundheitsökonomie, Krebsinformationsdienst, Epidemiologischem Krebsregister BW )
Die COVID-19-Pandemie hatte Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme weltweit. In dieser bevölkerungsbasierten Querschnittserhebung wurden von Krebs Betroffene in Baden-Württemberg zu Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie befragt, darunter Einschränkungen im sozialen Leben, bei der Arbeit, in der onkologischen Versorgung und in wirtschaftlichen Aspekten.
Potentielle Folgen für die Gesundheit der Teilnehmenden wurden ausgewertet, um evidenzbasierte Empfehlungen für gesundheitspolitische Maßnahmen abzuleiten. Die Studie ergab, dass etwa ein Fünftel der Teilnehmer von Veränderungen in der onkologischen Versorgung berichteten. Diejenigen, die Veränderungen in der aktiven Behandlung berichteten (z. B. Verzögerung der Operation, Änderung des Chemotherapieschemas), berichteten über signifikant mehr Depressionen und Angstzustände, mehr Symptome und eine geringere Funktionsfähigkeit und allgemeine Lebensqualität.
Die bis 2026 an das Krebsregister gemeldeten klinischen Daten werden zur Bewertung weiterer klinischer Aspekte verwendet, z. B. ob eine Verzögerung der Diagnose und des Therapiebeginns mit einer höheren Rezidivrate oder einer schlechteren Überlebensrate verbunden ist.
CapGer – Cancer prevalence in Germany / Krebsprävalenz in Deutschland (in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD)
Bedingt durch verbesserte Überlebensraten, aber auch durch die demografische Alterung steigt die Zahl in Deutschland lebender Personen mit bzw. nach einer Krebserkrankung. Allerdings fehlten bislang detaillierte Angaben zur Krebsgesamtprävalenz in Deutschland. Ziel der Studie war die Ermittlung der Gesamtzahl der in Deutschland lebenden Personen mit oder nach einer Krebserkrankung (Cancer Survivors) aufgeschlüsselt nach Tumorentität, Geschlecht, Alter und Zeit seit Diagnosestellung. Hierzu wurde zunächst die 25-Jahres-Krebsprävalenz in Deutschland anhand der aktuellsten vom Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) am Robert Koch-Institut verfügbaren Angaben zu Krebsinzidenz und Überleben mithilfe der Methode von Pisani et al. berechnet. Anschließend wurden die nach Tumorentität, Alter und Geschlecht stratifizierten 25-Jahres-Prävalenzen unter Zuhilfenahme der entsprechenden Quotienten aus Gesamtprävalenz und 25-JahresPrävalenz aus den Surveillance-Epidemiology-and-End-Results(SEER)-Daten zur Lebenszeitprävalenz hochgerechnet.
Die Ergebnisse zeigen, dass Ende 2017 in Deutschland insgesamt 4,65 Mio. Personen mit bzw. nach einer Krebserkrankung, darunter 2,10 Mio. Männer und 2,55 Mio. Frauen, lebten und die Zahl derzeit pro Jahr um 100.000 Personen anwächst. Aufgrund der demografischen Alterung und insbesondere des Eintritts der „Babyboomer“ in die Generation der über 50-Jährigen wird die Zahl der Personen mit oder nach einer Krebserkrankung in Deutschland in den kommenden Jahren weiter steigen.

EORTC QLQ-SURV – EORTC Quality of Life Questionnaire, Survivorship module (in Kooperation mit dem Netherlands Cancer Institute und der EORTC-QLQ-Studiengruppe)
Bisherige Instrumente zur Bewertung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (LQ) wurden hauptsächlich zur Erfassung der LQ während der akuten Behandlungsphase entwickelt. Angesichts der wachsenden Zahl von Personen nach einer Krebsbehandlung ist es wichtig, die gesundheitsbezogene Lebensqualität in der „Survivor-Phase“ zu erfassen. Hier können Langzeit- und Spätfolgen auftreten. Dazu gehören anhaltende Erschöpfung (Fatigue), Schmerzen, muskuloskelettale Probleme, periphere neurologische Symptome (z. B. Polyneuropathie), Probleme mit dem Körperbild, sexuelle Funktionsstörungen, Beziehungsprobleme, kognitive Dysfunktionen, Angst und Depression sowie die Angst vor einem Wiederauftreten/ Fortschreiten der Erkrankung. Weitere Probleme können sozioökonomische Herausforderungen wie die Rückkehr an den Arbeitsplatz, Einkommensverluste oder Schwierigkeiten bei der Erlangung von Versicherungen, Finanzkrediten, Hypotheken umfassen. Es gibt andererseits auch Hinweise darauf, dass eine überstandene Krebserkrankung positive psychologische Auswirkungen haben kann. All diese Auswirkungen, sowohl positive als auch negative, können sich auf die Lebensqualität des Einzelnen auswirken. Das Projekt hat zum Ziel, unter engem Einbezug von Betroffenen ein Instrument zu entwickeln, das die Lebenssituation von Personen nach einer Krebserkrankung berücksichtigt. Die Entwicklung dieses Fragebogens hat bereits Phase I-III durchlaufen. In diesen Phasen wurde das Fragebogenmodul (SURV-100) entwickelt und vorab getestet. Darüber hinaus wurden drei krebsartspezifische Zusatzmodule für Brust- (BR-SURV45), Darm- (CR-SURV34) und Prostatakrebs (PR-SURV30) entwickelt.
Das Projekt befindet sich nun in Phase IV – der letzten Phase –, die eine groß angelegte internationale psychometrische und kulturübergreifende Validierungsstudie des erstellten Fragebogens umfasst.

PROCAS – Prostate Cancer Survivorship in Switzerland / Leben mit und nach Prostatakrebs in der Schweiz (in Kooperation mit der Stiftung Nationales Institut für Krebsepidemiologie und –registrierung, c/o Universität Zürich, Schweiz)
Ziel dieser Studie war es, die gesundheitsbezogene Lebensqualität (LQ) und die Spätfolgen der Behandlung bei Langzeitüberlebenden von Prostatakrebs (fünf und mehr Jahre nach der Diagnose) besser zu verstehen. Die Studie untersuchte soziodemographische und medizinische Determinanten der LQ, wie die Art der Behandlung, das Alter und Begleiterkrankungen, mit dem Ziel, die Nachsorge zu verbessern.
Die Ergebnisse zeigten beispielsweise, dass Langzeitüberlebende nach nervenschonender Prostataektomie über eine ähnliche Symptombelastung und eine vergleichbare allgemeine Lebensqualität verfügen wie Langzeitüberlebende, die nicht nervenschonend operiert wurden. Die einzigen Unterschiede wurden bezüglich der sexuellen Aktivität gefunden. So berichteten Männer nach nervenschonender Operation über eine höhere sexuelle Aktivität als diejenigen, die nicht nervenschonend operiert werden konnten. Bezüglich Harninkontinenz und anderer Skalen der eingesetzten Lebensqualitätsinstrumente fanden sich keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.

LinDe – Lebensqualität in Deutschland (in Kooperation mit Klinische Epidemiologie und Alternsforschung)
Um mögliche funktionale Beeinträchtigungen und Langzeitfolgen bei Krebsbetroffenen zu identifizieren und quantifizieren, ist es wichtig zu vergleichen, ob es Unterschiede in der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (LQ) zur deutschen Allgemeinbevölkerung gibt.
Die LinDe-Studie wurde ins Leben gerufen, um für Studien mit Krebsbetroffenen Referenzdaten zur LQ und zu weiteren potenziellen Problemen (Stress, Depressivität) zu generieren.
Die Studien mit LinDe-Daten zeigten, dass zwar die allgemeine LQ von Krebsbetroffenen mit der von gleichaltrigen Kontrollen vergleichbar ist, jedoch spezifische Unterschiede in Symptomen berichtet werden, selbst viele Jahre nach der Diagnose. Weiter wiesen z.B. unter 80-jährige Langzeitüberlebende von Brustkrebs eine signifikant höhere Prävalenz von depressiven Symptomen gegenüber gleichaltrigen Frauen ohne Krebs auf (30% zu 24%). Dies war aber hauptsächlich der Fall, wenn der Brustkrebs metastasiert oder seit der Erstdiagnose ein Rezidiv aufgetreten war.

CAESAR – Cancer Survivorship – a multi-regional population-based study/ Leben mit und nach Krebs – eine multizentrische, populationsbasierte Studie (in Kooperation mit Klinische Epidemiologie und Alternsforschung und sechs bevölkerungsbezogenen Krebsregistern in Deutschland)
Angesichts immer höherer Überlebensraten von Krebs gewinnen Aspekte der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (LQ), der aktuellen Lebenssituation sowie die Frage nach möglichen Spätfolgen zunehmend an Bedeutung.
Die erste Erhebung der Studie wurde 2009/2010 bevölkerungsbezogen in sechs Bundesländern (Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Bremen und Saarland) durchgeführt.
An der Studie haben über 7.000 Personen mit einer mindestens 5 Jahre zurückliegenden Diagnose von Brust-, Darm- oder Prostatakrebs teilgenommen. Die Teilnehmenden füllten einen Fragebogen aus, der die LQ, den aktuellen Gesundheitsstatus sowie potentielle negative und positive Effekte einer Krebserkrankung erfasst.
Eine Nacherhebung der Studie wurde 2018/2019 durchgeführt. Sie richtete sich an alle Teilnehmer der Ersterhebung, die noch am Leben waren und ihre Einwilligung zur erneuten Kontaktaufnahme gegeben hatten. Über 2.700 Teilnehmer nahmen erneut teil.
Im Rahmen der Nacherhebung fand auch eine Befragung von behandelnden Ärzten der Teilnehmer statt, mit dem Ziel, Behandlungen und Komorbiditäten differenzierter zu erfassen.
Die Ergebnisse zeigen, dass Langzeitüberlebende nach Brust-, Darm- oder Prostatakrebs 5-15 Jahre nach Diagnose insgesamt eine gute, der Allgemeinbevölkerung vergleichbare Lebensqualität berichten, sofern kein Rezidiv oder Zweittumor aufgetreten ist. Allerdings fanden sich Defizite bei jüngeren Langzeitüberlebenden vor allem im psychosozialen Bereich und insgesamt ein tumorspezifisches Beschwerdemuster. Auch zeigten sich bei den Langzeitüberlebenden nach Darmkrebs Hinweise auf geschlechtsspezifische Beeinträchtigungen bei Sexualität und Körperbild. Erfreulicherweise sind fast zwei Drittel der Langzeitüberlebenden im erwerbsfähigen Alter nach Brust-, Darm- oder Prostatakrebs in der Lage, wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren Es wurden jedoch finanzielle Probleme im Falle einer Umschulung oder nach Reduktion der Arbeitszeit beobachtet, die die gesundheitsbezogene Lebensqualität beeinflussen können. Auch fast 10 Jahre nach der Initialerhebung, also 14-24 Jahre nach Diagnose einer Krebserkrankung, fanden sich noch vermehrt spezifische Symptome und Funktionseinschränkungen. Das Muster variierte je nach Alter, Geschlecht und Krankheitsstatus. Insgesamt bewerteten aber diese Langzeitüberlebenden ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität bzw. ihren allgemeinen Gesundheitsstatus sogar etwas besser als gleichaltrige Menschen, die nie an Krebs erkrankt waren. Trotz dieses erfreulichen Befunds weisen die Ergebnisse jedoch auf die Notwendigkeit eines umfassenden, risikoadaptierten Survivorship-Care-Programms hin, um mögliche Spät- und Langzeitfolgen nach der Diagnose und Behandlung von Krebs zu erfassen und frühzeitig zu behandeln.
Team
Cancer Survivorship befasst sich mit zahlreichen Aspekten im Leben von Krebsüberlebenden. Diese Multidisziplinarität spiegelt sich in den vielfältigen beruflichen Hintergründen unseres Teams wider (u.a. Medizin, klinische Epidemiologie, (Gesundheits-)Psychologie, Physiotherapie, Pharmazie, Gesundheitswesen, Ökonomie):
-
Maya Basbous
- Profil anzeigen

Dr. Daniela Doege
-

Julien Frick
-
Yifeng Gao
-
Chien-Tzu Lee
-
Zhiwei Lian
-

Stuti Sinha
- Profil anzeigen

Dr. Melissa Thong
-

Chunsu Zhu
-

Zhounan Zhu
Ausgewählte Publikationen
Doege D, Frick J, Eckford RD, Koch-Gallenkamp L, Schlander M, Baden-Württemberg Cancer Registry, Arndt V.
Thong MSY, Boakye D, Jansen L, Martens UM, Chang-Claude J, Hoffmeister M, Brenner H, Arndt V.
Arndt V, Koch-Gallenkamp L, Jansen L, Bertram H, Eberle A, Holleczek B, Schmid-Hopfner S, Waldmann A, Zeissig SR, Brenner H.
Kontaktieren Sie uns

